Während die Großen 20 in Hamburg über den Welthandel, die Zukunft Afrikas und den Klimawandel debattierten, befassten sich die Vereinten Nationen in New York im Schatten des Gipfels der Mächtigen mit einer für die Existenz des blauen Planeten nicht minder wichtigen Frage. Rund 130 Staaten verabschiedeten dort ein Abkommen zum Verbot von Atomwaffen.
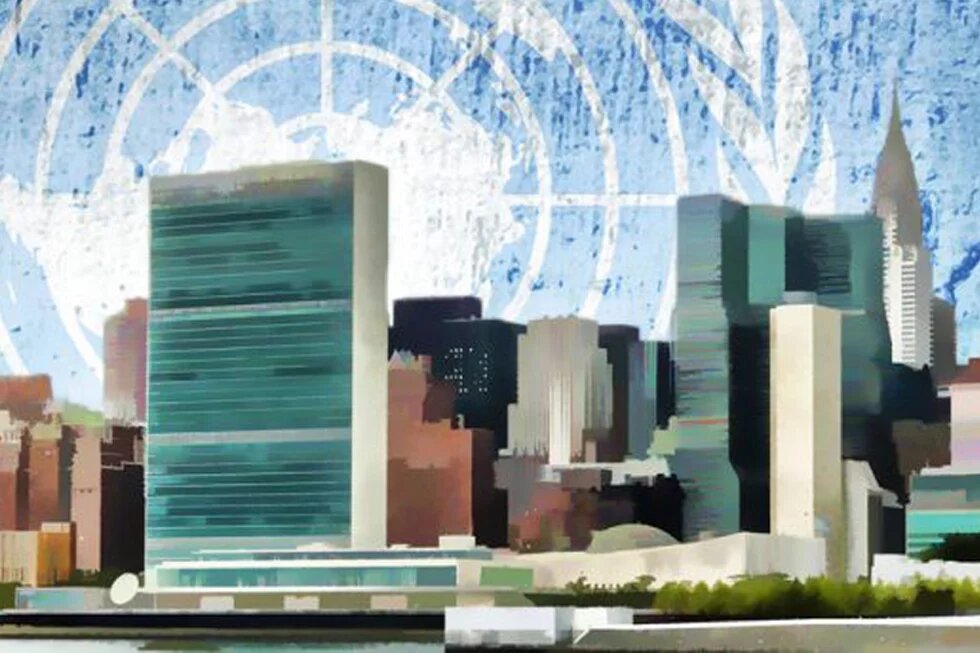
Mit diesem Vertrag vollzieht sich eine historische Wende in der Nuklearpolitik. Erstmals rücken die menschliche Sicherheit und die katastrophalen humanitären Folgen von Atomwaffen ins Zentrum der Diskussionen und der Regelungen rund um Atomwaffen. Den Anstoß hierfür gaben vor allem die internationale Zivilgesellschaft und Staaten, die keine Atomwaffen besitzen. Sie haben nun den Aufstand gegen die Nuklearmächte gewagt und eine neue Ära in der Abrüstungspolitik eingeleitet.
Über Jahrzehnte steckte die Abrüstungsmaschinerie im nuklearen Bereich fest. Die Spannungen zwischen den Großmächten haben jede sicherheitspolitische Zusammenarbeit in eine Sackgasse getrieben. Das von den USA ausgerufene und von nahezu allen Staaten offiziell mitgetragene Ziel einer atomwaffenfreien Welt war schon seit einigen Jahren wie ein Traum aus alter Zeit verblasst.
Die überwältigende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft hat dieses Versprechen an die nachfolgenden Generationen nun wieder auf die Agenda gesetzt. Nicht als Debattenpunkt, sondern in Form einer völkerrechtlich verbindlichen Norm. Maßgebliche Initiatoren waren Österreich, Irland, Südafrika, Nigeria, Brasilien und Mexiko. Ihnen folgte ein großes, fast alle Kontinente umspannendes Bündnis. Mit dem in New York verabschiedeten Atomwaffenverbot errichten die atomwaffenfreien Staaten ein großes Stoppschild gegenüber den Atomwaffenstaaten. Der Vertrag, der neben der Herstellung, dem Einsatz und Besitz auch die Drohung mit einem Nuklearschlag sowie die Stationierung von Atomwaffen in anderen Staaten verbietet, setzt einen Kontrapunkt zu den weltweiten Aufrüstungsdynamiken und der Renaissance des nuklearen Wettstreits der Großmächte.
Darüber hinaus machten die Unterstützerstaaten der Ächtung klar, dass nukleare Abrüstung künftig nicht mehr eine Frage sein wird, die allein die Atomwaffenstaaten betrifft und um die sie sich ungestört herum drücken können. Der Anspruch der atomwaffenfreien Staaten auf ein Mitspracherecht in der nuklearen Abrüstung zieht sich wie ein roter Faden durch alle Passagen und Artikel. Der Vertragstext macht den Weg frei für ein umfassendes Kontroll- und Verifikationsregime, das für alle gleichermaßen gilt. Bisher mussten sich nur Staaten, die keine Atomwaffen besitzen, Sicherheitsvorkehrungen unterziehen. Jetzt wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass auch Atomwaffenstaaten in die Pflicht genommen werden.
Doch was genau deckt der Vertrag alles ab?
Ausgangspunkt sind die humanitären Folgen von Atomwaffen. Daher werden in der Präambel die katastrophalen humanitären Auswirkungen und die Unmöglichkeit, hierauf beim Katastrophenmanagement adäquat zu reagieren, hervorgehoben. Atomwaffen dürfen niemals und unter keinen Umständen mehr eingesetzt werden. In der Präambel wird das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt unter Bezug auf nationale und globale Sicherheitsinteressen bekräftigt.
Nicht nur die Entwicklung, Herstellung, der sonstige Erwerb, Besitz, die Lagerung, Weitergabe, der Einsatz und Tests von Atomwaffen sind verboten. Auch jegliche Unterstützungsleistungen hierzu werden untersagt. Hinzu kommen das Verbot der Einsatzdrohung „use or threaten to use“ (Art. 1.(d)), womit jede Politik der Abschreckung eindeutig delegitimiert wird sowie das Verbot der Stationierung in Art. 2.. Damit handelt künftig auch die Bundesregierung mit der nuklearen Teilhabe in der NATO und der Verfügung über US-Atomwaffen in Deutschland gegen geltendes Völkerrecht. Eine seit Jahrzehnten juristisch hoch umstrittene Praxis findet damit eine eindeutig völkerrechtliche Klärung. Die Bundesregierung blieb aus diesem Grund und auf Druck der USA den Verhandlungen fern.
Darüber hinaus bringt das Abkommen weitreichende Verbesserungen des Opferschutzes für Menschen, die von Atomwaffeneinsätzen- und Tests betroffen sind. Neben Auflagen zur Opferhilfe beinhaltet er auch Maßnahmen zur Rehabilitation der Umwelt (Art.6).
Auch wenn das Abkommen an sich eine trag- und durchsetzungsfähige Grundlage für die internationale Ächtung von Atomwaffen darstellt, bleiben noch Baustellen bestehen. Die größte Herausforderung stellt dabei gewiss die Einbeziehung der Atomwaffenstaaten dar. Hierfür schafft der Text eine solide Grundlage. Die Offenheit der Formulierungen gegenüber Staaten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beitreten können oder wollen, sorgt dafür, dass das Regelwerk lebendig bleibt und sein Geltungsbereich schrittweise erweitert werden kann.
Recht auf zivile Nutzung Nukleartechnologie
Ein problematischer Punkt ist die Verankerung des Rechts auf zivile Nutzung von Nukleartechnologie in der Präambel. Der Vertrag hat weder die Aufgabe, noch die Kapazitäten, die zivile Nutzung so umfassend wie nötig zu regeln. Indem das Recht darauf nun festgeschrieben wurde, hat man die Chance verpasst, eine wichtige Lehre aus dem Atomwaffensperrvertrag zu ziehen: Die Verbreitung von Atomenergie trägt wesentlich zur Proliferation von Atomwaffen bei.
Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt sind die Sicherheitsstandards: Artikel 3 und 4 decken nahezu das gesamte Verifikationsspektrum ab und verleihen dem Vertrag für die Überprüfung und Kontrolle der Verbote Glaubwürdigkeit und Autorität. Ein Schwachpunkt ist jedoch die Möglichkeit des Austritts aus dem Vertrag, ein Kompromiss, den ehrgeizige Staaten für eine größere Zahl an Unterzeichnern eingehen mussten.
Die Zeitspanne, um aus dem Vertrag auszutreten, wurde immerhin mit zwölf Monaten überdurchschnittlich ausgeweitet. Ein Austritt in Zeiten, in denen der betreffende Staat in einen bewaffneten Konflikt involviert ist, wurde ausgeschlossen. Die Hürden für einen Austritt sind somit trotz allem hoch.
Das Verbot schließt eine völkerrechtliche Lücke, die trotz des Endes des Kalten Krieges über Jahrzehnte nicht überwunden wurde. Bio- und Chemiewaffen sind schon lange verboten, doch Atomwaffen waren bis heute erlaubt. Dieses Paradox haben die atomwaffenfreien Länder nun beendet und diese Woche Geschichte geschrieben. Der Vertrag soll am 20. September 2017 in Anwesenheit der Außenminister bei der UN-Vollversammlung feierlich zur Unterschrift freigegeben werden. Notwendig sind 50 Ratifizierungen, damit der Vertrag 90 Tage später in Kraft tritt.
